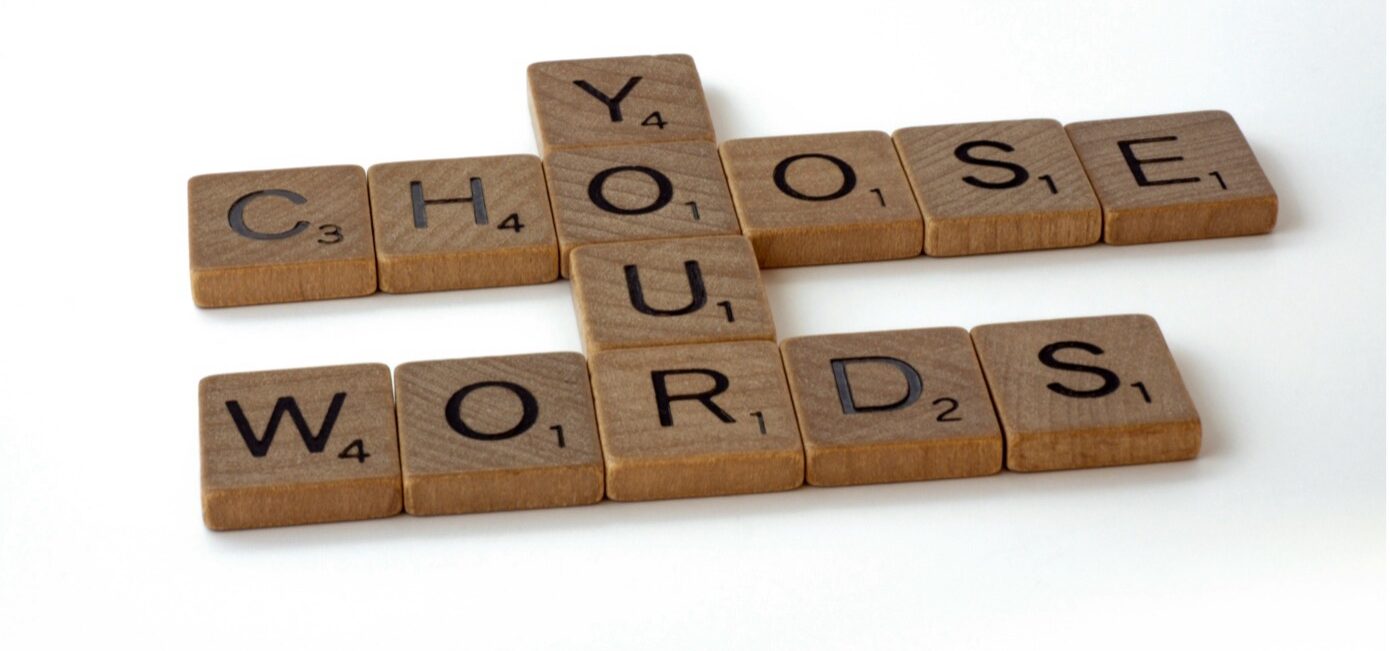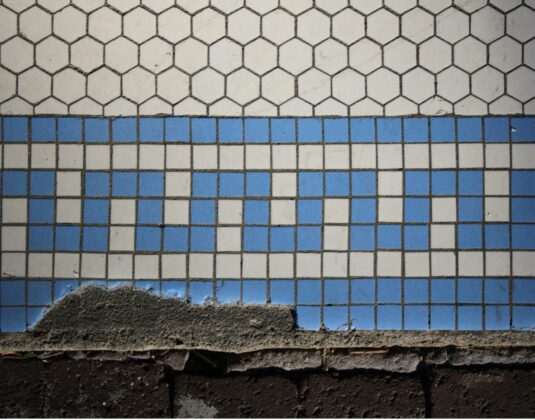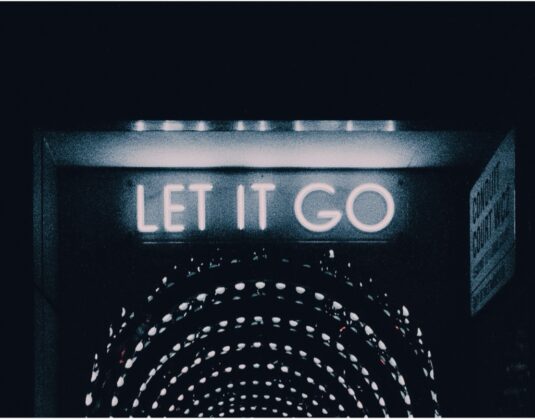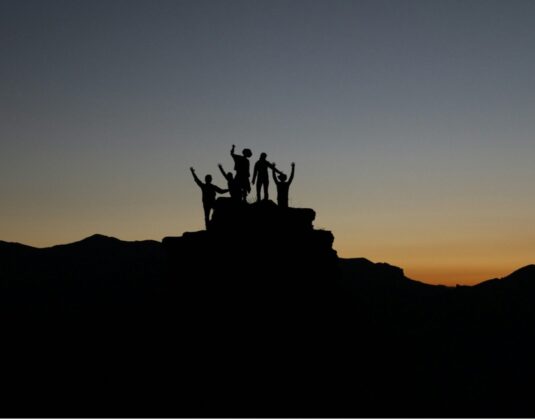Intro
Wenn wir bei Schlachtplan am Ende eines Workshops oder Trainings nach Feedback der Teilnehmenden fragen, schreiben wir zumeist wortwörtlich mit. Und mit wortwörtlich meinen wir wortwörtlich, also genau die Worte und Sätze, die uns die Teilnehmenden nennen.
Warum machen wir das? Es macht einen Unterschied, ob am Ende auf dem Flipchart steht: „Ich habe mal wieder gemerkt, dass ich einfach die coolsten Kollegen der Welt habe“ oder „gute Gruppendynamik“, ob da steht „fantastisches Essen und Eisbar“ oder „gute Verpflegung“ oder „Ihr habt das wirklich grandios gemacht“ anstatt „gute Moderation“.
Worte können Emotionen transportieren, Bilder schaffen und Erinnerungen aktivieren – ja, oder eben auch nicht.
Diesen Themenmonat dreht sich alles um die Macht der Sprache.
Willkommen im Mai und viel Spaß beim Lesen!
Input
„Worte schaffen Welten“ – klingt poetisch? Ist aber Alltag.
Denn Sprache ist kein neutrales Transportmittel. Sie ist ein Gestaltungstool:
- Wenn ich von Herausforderungstatt Problem spreche, verändere ich die Blickrichtung.
- Wenn ich sage „Ich werde das heute noch abschließen“statt „Ich muss das noch machen“, verändere ich meine Haltung.
- Wenn in Teams von „wir“statt „die da oben“ gesprochen wird, verändert sich das Gefühl zum Miteinander
Sprache formt Wahrnehmung, Denken, Beziehungen.
In der Psychologie nennt man das „Linguistic Framing“ – die Worte, die wir wählen, rahmen unsere Realität.

Der Begriff bezeichnet die bewusste oder unbewusste Wahl von Worten und Formulierungen, um bestimmte Interpretationen, Reaktionen und Emotionen beim Gegenüber auszulösen. Dabei beeinflusst nicht nur der Inhalt, sondern vor allem die sprachliche Verpackung zum gewählten Wort – also Betonung, Mimik und Gestik und auch die Wortwahl, wie die Informationen aufgenommen und verarbeitet werden.
So sind Früchte im Supermarkt nicht einfach nur Früchte, sondern „sonnengereift“. Das löst in uns ein wohliges warmes Gefühl, Zufriedenheit und Genuss aus. Gekauft!
Framing-Effekte werden häufig bewusst eingesetzt, um Menschen zu einer bestimmten Meinung oder Handlung zu bewegen, z.B.:
- „Diese Maßnahme hat eine 90 %ige Erfolgsquote.“
- „Diese Maßnahme hat ein 10 %iges Risiko zu scheitern.“
Der Inhalt ist derselbe, aber wenn du dein Team von einer Maßnahme überzeugen willst, welchen Satz wählst du? Welcher Satz fühlt sich besser an? Welcher macht Mut? Welcher erzeugt Unsicherheit? Der Inhalt ist identisch, aber das Framing verändert sich.
Unbewusst schätzen wir die positiv beschriebene Option attraktiver ein als die negativ beschriebene und leiten daraus unsere Handlung ab.

Eine Studie zum strategischen Framing in politischen Kampagnen beschäftigte sich mit der Semantik im politischen Marketing und deckte Mechanismen des Framings auf, welche bewusst eingesetzt werden, um Meinungen und auch Wahlentscheidungen zu beeinflussen.
Worin unterscheidet sich beispielsweise der Ausdruck:
- „Tax relief“ (wörtlich: Steuerentlastung) von „Investition in die Gemeinschaft“? Der Erste Ausdruck impliziert eine Last und ein Leiden. Der zweite hingegen setzt auf den Wert des Zusammenhaltes, des Miteinanders.
- Oder „illegale Einwanderer“ im Gegensatz zu „wirtschaftliche Flüchtlinge“? Der erste Ausdruck impliziert Ungerechtigkeit und schürt Ärger. Der zweite hingegen setzt auf Verständnis, indem er Kontext gibt.
Ein Frame arbeitet also mit einer werteaufgeladenen Sprache. Das Marketing fragt nach Emotionen und Werten, die transportiert werden sollten und entwickelt daran eine passende Sprache. Ein „guter“ Frame benennt indirekt ein Problem und Schuldige, spielt mit moralischer Bewertung und schlägt insgeheim auch eine Lösung vor. Alles im Grunde zwischen den Zeilen.
Hinzu kommt, dass Menschen eher zu einer monoperspektivischen Wahrnehmung neigen, das heißt zumeist eine einzige vorgegebene Perspektive schneller übernehmen – und zwar die, die sprachlich am passendsten vorgegeben wurde. Das ist wie im Matheunterricht früher: Der Lehrer erklärt uns einen Lösungsweg für die Gleichung. Dieser ist dann das Mittel der Wahl und wird als „richtiger“ empfunden, als andere mögliche Lösungswege. Vor allem dann, wenn man selbst kein besonders gutes mathematisches Verständnis hat. Dann ist der Lösungsweg des Lehrers der beste Weg. Um aber ein mathematisches Verständnis zu entwickeln, sollte man mehrere Lösungswege verstehen. Das ist dann ein mehrperspektivischer Ansatz.
Ein mehrperspektivischer Diskurs – vor allem in der Politik – könnte so schließlich festgefahrenen Meinungsbildern entgegenwirken, empfehlen die Autor*innen.
(Quelle: „The Linguistic Aspect of Strategic Framing in Modern Political Campaigns“, Agnieszka Pluwak, 2011)
Inside

Wir erkennen: Sprache transportiert in erster Linie Emotionen, dicht gefolgt von der eigentlichen Information. Aber letztlich sind es Emotionen und Bilder, welche sich in unserem Gedächtnis einbrennen und auch abrufbar sind. Je abstrakter eine Mitteilung, desto schwieriger können wir sie erinnern. Das zeigen wir in einem Beitrag anhand äußerst berühmter Beispiele.
Bekannterweise besteht unsere Kommunikation aus drei Ebenen:
- Verbal – die gesprochenen oder geschriebenen Worte.
- Paraverbal – die Art und Weise, wie wir sprechen: Tonfall, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit.
- Nonverbal – unsere Körpersprache: Mimik, Gestik, Haltung, Blickkontakt.
Wie diese drei Ebenen zusammenwirken und unsere Botschaften beeinflussen, klären wir zum #methodenmittwoch und versuchen gleich, dich mit einer kleinen Übung dafür zu sensibilisieren.
__________________________
Exkurs
An dieser Stelle möchten wir übrigens auf ein Missverständnis aufmerksam machen, was in diesem Zusammenhang immer wieder zitiert wird: Die Mehrabian-Regel.
Albert Mehrabian stellte in den 1960er Jahren in einem Experiment deutlich heraus, dass bei der Kommunikation von Gefühlen, die Verteilung dieser Kanäle eine besondere ist. Demnach kommt es nur zu 7% auf die gesagten Worte (verbale Mittel) an, zu 35% auf den Tonfall (paraverbale Mittel) und zu 55% auf die Körpersprache (nonverbale Mittel). Häufig wurde diese Regel jedoch allgemein in Bezug auf die interpersonelle Kommunikation weitergetragen. Das hat Albert Mehrabian verärgert und er stellte in einem Beitrag nochmals deutilch heraus, dass diese Verteilung eben nicht auf alle Arten der Kommunikation zutrifft, sondern nur bei der Kommunikation von Gefühlen oder gefühlsgeladenen Aussagen.
(Quelle: Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes. Wadsworth, A. Mehrabian, 1971)
__________________________
Außerdem klären wir in diesem Themenmonat, wie wir unsere Sprechweise auch dazu nutzen, um Sympathie oder Antipathie deutlich zu machen und warum wir uns nicht frühzeitig „im Ton vergreifen“ sollten.
Outro

„Worte schaffen Welten“ – Welche „Welten“ schafft ihr in euren Meetings? Als kleine Outro-Übung bekommst du die Aufgabe: Achte einen Tag bewusst auf wiederkehrende Begriffe in Meetings und frage dich: Stärken sie Vertrauen, Mut und Klarheit – oder das Gegenteil?